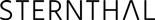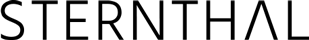Erkundungsreisen des Möglichen
»Nach biblischer Überlieferung«, schrieb Leo Tolstoi in seinem Jahrhundertroman Krieg und Frieden, »war die Abwesenheit von Arbeit – der Müßiggang – Bedingung für die Glückseligkeit des ersten Menschen vor seinem Fall.« Was folgte, waren der Sündenfall und damit die Ambivalenz: Die Liebe zum Müßiggang war dieselbe geblieben, doch nun war das süße Nichtstun von Pflicht und Arbeit belastet. Eine effektive Daseinsberechtigung hatte, so scheint es, nur der, der schafft, nicht aber jener, der dem Müßiggang huldigt. Diesem haftet nach wie vor etwas Unmoralisches an, ein Hauch von Verbotenem, ja geradezu Laszivem. Sind wir müßig, fühlen wir uns nur dann nicht schuldbewusst, wenn wir vorher bis zur Erschöpfung geschuftet haben.
Schade, denn ein seelenhygienisches Verhängnis ist die Prävalenz einer Kultur der Arbeitsamen allemal. Bedenkt man nämlich den einen wesentlichen kategorischen Imperativ der Psychologie, Müßiggang, Spaß haben, Lachen und Spielen seien evidente Königswege zu Kreativität, zu einem Glücksempfinden und mithin zu psychischer und physischer Gesundheit, so sollte man eigentlich sehr viel mehr Wert auf diese Mußestunden legen, als wir alle dies gemeinhin tun. Fügen wir der Muße noch das Spiel hinzu, ergibt sich eine Art unerschöpfliche Ladestation für den menschlichen Energiehaushalt.
Stellen Sie sich einmal einen Meeresstrand vor. Blauer Himmel, ein paar feine Wellen, Sonnenschein. Und schon werden wir alle zu Kindern, hüpfen im flachen Wasser umher, tauchen durch die Wellen, fühlen uns ganz frei und doch den Elementen ausgeliefert. Wir sind ganz im Hier und Jetzt – da ist nichts als die pure Leichtigkeit des Seins. Die Intensität, mit der ein Mensch hier seine Batterien auf- und seine Alltagsfrustrationen ablädt, ist kaum zu überschätzen.
Etwas ganz Ähnliches geschieht, wenn wir zu Hause spielen – mit der Familie, mit Freunden, den Kindern. Im Prinzip ist es ganz egal, ob es sich um ein Brettspiel handelt, um Kartenspiele, Rollenspiele oder etwas dazwischen: Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass Spielen ein effektives Lerninstrumentarium darstellt und darüber hinaus die Kreativität anregt. Für Kinder und junge Menschen ist das enorm wichtig – für Ältere ebenso, wollen sie sich, salopp formuliert, die Elastizität ihrer Ganglien erhalten. Spielen, so zeigen aufwendige Studien, fördert das Denken, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Findigkeit, wenn situationsangepasste Lösungen gefragt sind. Fähigkeiten also, die jeder Mensch zu allen Zeiten und Gelegenheiten gut gebrauchen kann.
Daraus folgt der logische Schluss: Jene Stunden, die wir mit Spielen zubringen, sind sinnvoll verbracht und alles andere als Zeitvergeudung! Wobei natürlich klar sein muss: Die Rede ist hier nicht vom sinnbefreiten Gaming am PC, sondern vom lebendigen Spielen, das die Gehirne von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zur Höchstform auflaufen lässt. Ob das nun ein Spiel mit Karten ist, ein Brettspiel im Kreis von Freunden oder das Spiel eines Kindes, das sich zwischen Küche, Kinderzimmer und Garten tausend und ein Ding findet, mit denen es ganze Universen gestaltet, ist dabei relativ gleichgültig.
Geht es um Kinder, so ist die Bedeutung des Spielens genauestens erforscht, und zwar sowohl auf pädagogischer wie auf psychologischer und neurologischer Ebene. Wie der Neurobiologe Gerald Hüther schrieb, ist Spielen eine Art »Feuerwerk für die grauen Zellen«: Spielen befreit, aber es verbindet auch mit jenen, mit denen wir spielen, und es lässt uns lernen, denn beim Spielen erkunden wir Bereiche, die wir in unserem gewohnten Alltag oft gar nicht betreten.
Spielen, das ist eine Erkundungsreise des Möglichen, eine Entdeckung der Welt und des individuellen Handlungsspielraums darin. So wird das Spielen zum Gegenteil des ewigen Reproduzierens, wie es uns Schule und später vielleicht Hochschule oktroyieren und abverlangen. Spielen fördert nicht das Weiterdenken von Vorhandenem – im angelsächsischen Raum als »linear innovation« bezeichnet –, sondern das Denken und Entwickeln von etwas ganz Neuem, möglicherweise sogar einer »breakthrough innovation«. Die großen Erfindungen dieser Welt, die umwälzenden Erneuerungen haben ihre Wurzeln alle im Spiel. Oder was dachten Sie, wie die Gebrüder Montgolfier auf die glorreiche Idee kamen, einen Ballon mit heißer Luft zu füllen und damit in die Lüfte zu steigen? Die pfiffigen Brüder haben probiert und gespielt, sind Risiken eingegangen, haben Pech gehabt und dann wieder Glück. Der Rest ist Geschichte.
Aber noch viel mehr verdankt sich dem Spiel. Johan Huizinga, niederländischer Historiker und Kulturphilosoph, untersuchte in seinem 1938 erschienen Jahrhundertwerk Homo ludens den Ursprung aller Kultur im Spiel. Für Huizinga ist das Spiel die Basis unserer Kultur. Huizinga betrachtete den Menschen als einen Spieler sui generis, der ohne diese Fähigkeit umfassende, kulturell substanzielle Bereiche überhaupt nicht entwickelt hätte, gleichgültig, ob von Wissenschaft, Recht, bildender Kunst, Philosophie oder Dichtung die Rede ist. Letztlich tat Johan Huizinga mit seiner Analyse des Spielers nicht weniger, als dem Homo sapiens – dem Denker – und dem Homo faber – dem schaffenden Menschen – den Spieler als gleichberechtigte Größe innerhalb der gesamten menschlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung zur Seite zu stellen. »Kultur«, so hielt Huizinga fest, »entsteht in Form von Spiel.« Der vorhin bereits erwähnte Neurobiologe Gerald Hüther geht noch einen Schritt weiter und konstatiert: »Ohne das Spiel gäbe es keine Schönheit«, denn jeder Musiker spielt sein Instrument, jeder Maler spielt mit Farben, und Poeten spielen mit Worten. Nur im Spiel erleben wir die Welt gleichermaßen sinnvoll und beglückend.
Selbst Plato sprach sich für das Spiel aus, und ist sein Höhlengleichnis nicht auch so etwas wie ein Spiel, weil der größte Erkenntnisgewinn jenen winkt, die mutig den Aufbruch wagen, die Schatten an der Wand als nichtreale Projektionen erkennen und sich stattdessen dem Feuer und schließlich dem Ausgang ins Sonnenlicht zuwenden? Wenn man es genau betrachtet, ist auch das ein Spiel – eines, das Mut verlangt, eines, das – Huizingas Definition entsprechend – sein Ziel in sich selbst trägt, nämlich den Erkenntnisgewinn, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist: keine Schattenprojektion, sondern reale Form im Licht. Spiele sind schließlich auch real – manchmal ernst, manchmal ein heiteres Divertissement, aber immer den Einsatz wert.
In erster Linie aber hat das Spiel an sich eine unverzichtbare Bedeutung für den Menschen, für das Mensch-Sein. Würden wir aufhören zu spielen, so würden wir uns gleichzeitig der Möglichkeit berauben, das Leben in all seinen Facetten zu erkunden und uns gleichzeitig auf die Spur unserer eigenen Potenziale zu begeben. Jede Stunde, die wir konzentriert spielend verbringen, ist also eine, in der wir uns selbst im Idealfall ein Stück näherkommen.
Und so sei am Schluss noch einmal aus Leo Tolstois Krieg und Frieden zitiert: »Könnte der Mensch zu einem Zustand finden, in dem er, weil er müßig ist, sich als nützliches Wesen empfindet, das seine Pflicht erfüllt, dann hätte er eine Seite der ursprünglichen Glückseligkeit gefunden.« Das Spielen an sich ist ohne jeden Zweifel ein wunderbares Instrument, um einen beherzten Schritt in Richtung dieser ersehnten »Glückseligkeit« zu setzen.
Abbildung: Pieter Bruegel, Kinderspiele. Wikimedia Commons|gemeinfrei
Dieser Text ist eine gekürzte Version des Originals aus dem Buch 200 Jahre Piatnik